Die Scheu der Stringenz
Das Wenigste vom Text steht ja da. Und das wäre etwas zu Schönes: wenn der Text irgendwann nur noch aus einem geschriebenen Wort bestehen würde und trotzdem den Umfang beispielsweise eines Spaziergangs oder eines langen Wartens hätte. Wie aber versetzt man den auf der anderen Seite des Texts, den Leser, der man ja unter anderen Umständen auch selbst sein kann, in den Zustand, die Umgebung dieses einzigen Wortes zu lesen? – Nein, mit einem Wort gibt es keinen solchen Text, außer er stünde im Zusammenhang anderer Texte oder einem außertextlichen Zusammenhang, der Sender und Empfänger verbindet („… sie legte ihre Hand auf die meinige und sagte: ‚Klopstock!'“). Mit mehreren wenigen könnte es ihn aber geben. Die Worte konturieren das Nichtgesagte. Je schärfer die Konturen bzw. je gezielter das Nichtgesagte von Worten umstellt ist, umso deutlicher tritt es hervor. Wie nun führt der Text seinen Leser? In jedem Fall, meine ich, sollte er ihn führen, er sollte in seiner Strategie offenlegen, wie er gelesen sein will, wo es gemeinsame Wegstrecken Hand in Hand gibt und wo der Leser sich ebenso wie der Text selbst seinen Weg durchs Gelände bahnen muß. Ein Text kann eben genau diese Übergänge von der Stringenz zum Sprung vorführen, er kann seine verschiedenen Ebenen so verbinden, daß die Art der Verbindung auch auf andere Stellen des gleichen Textes übertragen werden kann, der Leser quasi in der Gangart des Textes sich in ihm fortbewegt. Woher weiß der Autor aber, wie geländesicher der Leser ist? Reise ich irgendwann allein, weil ich traumwandlerisch den Kopf unter einem Ast eingezogen habe, während der mir folgende Leser ohne eine Warnung nicht anders als dagegenlaufen konnte? Hätte ich etwas mehr sagen müssen? Konnte ich davon ausgehen, daß er weiß, das die Bäume um die Lichtung tiefer ansetzende Äste haben als im Waldinneren? Das weiß er natürlich schon, aber daß eine Lichtung kommen würde, hat er nicht sehen können, weil er immerzu nur auf meinen Rücken starren mußte, um meiner Sprunghaftigkeit überhaupt zu folgen. Und um wieviel schwieriger ist es für uns zusammenzubleiben, wenn das eigene Denken die größte Lust daran hat, die ihm als eindringlich verbunden erscheinenden Orte in kürzester Zeit im Geist zu besuchen, dieses zu jenem zu fügen, Nahes zu trennen. Übrigens ist es nicht so, daß ich hier eine Antwort auf diese Frage geben könnte.
Man könnte sich ja auch mal ein einfaches Thema nehmen, ein Gelände also, in dem die Navigation von vornherein für alle Beteiligten leichter ist. Aber man macht es dann wieder und wieder nicht, nur weil es nicht geht, etwas zu machen, bei dem man sich vor Langeweile nicht konzentrieren kann. Denn die Literatur dient mir gerade als Refugium der Komplexität. Ein Affekt (pathos) löst den Text aus. Etwas in seiner Momenthaftigkeit Unterkomplexes also, das sich jedoch bei näherer Erforschung als hochkomplex erweist, indem alles darin angelegt ist, was ich im Verlauf des Textes hervorbringen möchte, dessen Winkel und Verstecke ich zu erkunden mich aufmache, um die durch den Affekt vermutete Komplexität aufzuspüren.
Das hat verschiedene Folgen: eine davon ist die Verborgenheit der Stringenz oder besser ihre Scheu. Die schönste Stelle eines Bildes, hat ein Maler zu mir gesagt, müsse er immer übermalen, da sie sonst das ganze Bild stören würde. Aber darin, daß das Bild sie gekannt hat, ergänze ich, ist sie ja auch abwesend noch anwesend. Nämlich indem die anderen Stellen des Bildes ja in einem Bezug auf diese einmal vorhandene Stelle gestanden haben und auf sie, wie auf jede andere Stelle des Bildes, hin komponiert wurden. Wenn die eine Stelle dann auch nicht mehr da ist, so sind doch ihre Wirkungen, aus denen sich freilich nicht auf ihr Aussehen schließen lassen würde, noch im Bild. Die Scheu der Stringenz rührt also von einer Demut der Einzelheiten des Textes vor dem Ganzen her. Verschiedenes muß der Scheu der Stringenz wegen für das, was mein Text will, zurückstehen: Figuren, sie bleiben in ihrem Charakter mehr skizziert als ausgeführt, Handlung, sie würde, allzu spannend, die Aufmerksamkeit von dem, worum es geht, ablenken, Einzelheiten des Schauplatzes und der Zeit. Worum geht es: um den Moment eines aufscheinenden Dichterisch-Mythischen. Das ist, so gesagt, reichlich ungenau, angesichts der unterschiedlichen Ansätze der Mythenkonzepte. Eigentlich brauchte ich einen anderen Begriff als den des Mythischen, einen neuen, ich möchte aber auch hier lieber das nehmen, was schon da ist, als ein Neues erfinden, daß ich ebenso erst in seine Bedeutung stellen müßte wie das vorhandene. Einschränkend also: ich gebrauche den Begriff als eine Hilfskategorie.
Um nun den Kern dieses „Mythischen“ herauszuarbeiten, sehe ich zwei Möglichkeiten. Die erste ist, da es als das Dichterische nur ein „Gezeigtes Verborgenes“ sein kann, seine Aspekte zu betrachten. Die Reihenfolge dieser Aspekte, die im Text zwangsläufig eine lineare ist, bleibt dann mitunter auch eine zeitlang stringent, so daß sich ausschnittweise sogar eine Erzählung ergibt. Diese kann aber im Vollzug der Sache auch wieder verlassen werden, wenn es notwendig erscheint, einem anderen Aspekt zu folgen, der an dieser Stelle durch die veränderte Textsituation aufgerufen wird. Die Aspekte des Einen sind insofern nicht etwas Neues („wieso denn jetzt Hindukusch, eben waren wir doch noch im Museum?“) oder dichterischer Spuk, sondern im theologischen Sinn Hypostasen, die als ebenso eigenständig aufgefaßt werden müssen, wie sie an das Eine rückgebunden sind. Wie sich im Textgang um das Betrachtete die Perspektive verändert und sich neben Stadien der Zwischenperspektiven, physikalisch gesprochen: neben entropischen Zuständen, ab einer gewissen Verdichtung wieder andere Vollperspektiven bzw. Zustandsräume ergeben, so sind dabei interessant, weil einzigartig, nicht die Vollperspektiven sondern die Zwischenperspektiven, die ganz wie entropische Zustände in ihrem Vollzug irreversibel sind. Ich meine, wenn man um das Betrachtete, der Einfachheit halber nehme ich mal eine Skulptur, wieder zurückgeht, so kann man doch nicht wieder die vorhergehende Perspektive, die man an derselben Stelle in die andere Richtung sich bewegend, innehatte, einnehmen. Denn auf der dem Wahrnehmen zwangsläufigen Suche nach Kohärenz ergänzt man die unvollständige Zwischenperspektive bzw. Mischungslücke aus dem Zusammenhang des Vorherigen heraus. Die so aus der Zwischenperspektive gewonnene Ansicht des Gegenstandes ist die mir liebste, weil ich sie am wenigsten intendiert habe. Möglicherweise dienen die Vollperspektiven mir nur dazu, auf dem Weg zwischen ihnen mich der Entropie aussetzen zu können.
Eine weitere Möglichkeit, dem Mythos nachzugehen oder: nach dem Unsichtbaren zu starren, ist für mich, es in Bezug zu setzen bzw. das Sichtbare, mit ihm in Verbindung Stehende, untereinander in Bezug zu setzen und zu vergleichen. Das geht am prägnantesten, indem wesentliche Bedingungen wie Ort oder Zeit in Übereinstimmung gebracht werden (also z.B. eine Konstellation zu gleicher Zeit am anderen Ort zu denken oder zu anderer Zeit am gleichen Ort, einer der beiden Parameter muß jedenfalls gleich bleiben, da ja sonst kein Vergleich möglich ist). So ergibt sich die Möglichkeit, das Unsichtbare mit einem Sichtbaren in Deckungsgleichheit zu sehen. Was ich sagen will, ist schlicht, aber für mich immer noch eine der größten Provokationen des menschlichen Geistes (Provokation deshalb, weil es in der Möglichkeit des Geistes liegt und ihn dennoch überschreitet): die Disparität von Zeit oder Ort zusammenzuführen und die sich daraus ergebenden Verschiebungen zu betrachten. Schlicht außerdem deshalb, weil ich mir das Verfahren des Vergleichens gerne als ein geometrisches vorstelle. Die Geschlossenheit eines geometrischen oder überhaupt mathematischen Systems ist ja die reine Lust des Geistes und natürlich kann man seine Gesetze auf etwas außerhalb seines Systems liegendes wie Sprache nicht anwenden. Schlicht also, weil es schlicht nicht möglich ist. Aber gerade wegen dieser lockenden Schlichtheit und wegen ihrer Unmöglichkeit kann ich die Finger nicht davon lassen. Es ist immerhin nicht so leicht, etwas zu finden, das ein vollkommenes Instrument für die ihm zugedachten Zwecke ist (außerhalb der Mathematik kenne ich kein solches) und nur aus einer nicht in ihm liegenden Schuld nicht anwendbar ist. Die Schuld bzw. Verantwortlichkeit ist vielmehr meine, daß ich es seinen Bedingungen entreiße und in ein ihm Fremdes bringe. Und das deckt sich ziemlich mit der Schuldigkeit, die ich dem Stoff gegenüber empfinde: daß ich ein ihm vollkommen Entsprechendes, aber gänzlich Fremdes ihm zugeselle, an dem er zu einem anderen werden kann. Beide natürlich werden zu anderem. Was den weiteren Vorteil hat, daß die Mittel oder Werkzeuge nach jedem solchen Vorgang verbraucht sind und neu erfunden werden müssen und er unwiederholbar ist, weil beide Ausgangsstoffe nicht mehr vorhanden sind.
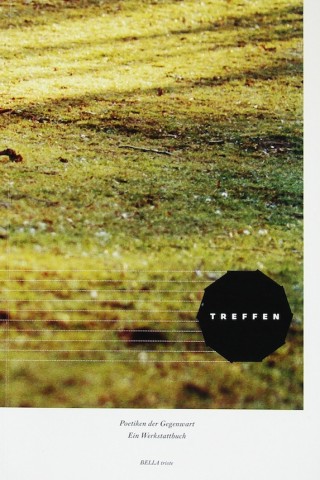
treffen – Poetiken der Gegenwart
Ein Werkstattbuch
Hildesheim, BELLA triste 2008
ISBN 978-3-9812363-0-9
