Kategorie: Poetik
Das schwierige Wort Vaterland
Das schwierige Wort Vaterland
zu: „V“
Jens-Fietje Dwars im Gespräch mit Daniela Danz über ihren Gedichtband „V“
Erschienen in: Palmbaum. Literarisches Journal aus Thüringen. Heft 1/2014
Ihr neuer Gedichtband, der zur Buchmesse beim Wallstein-Verlag erscheint, trägt einen einzigen Buchstaben als Titel: V. In der Verlagsankündigung heißt es, „V“ sei eine Chiffre für den schwierigen Begriff Vaterland. Warum gerade jetzt dieses Thema?
Vaterland ist eigentlich noch mehr als schwierig, das ist ein Begriff, den viele mit guten Gründen überhaupt nicht mehr verwenden wollen, gerade weil er von links und rechts gleichermaßen vereinnahmt wurde und vereinnahmt wird. Ich glaube aber, dass sich dieses Wort vor seiner Vereinnahmung nur schützen lässt, indem man seine Komplexität präsent hält. Der Begriff Heimat hat vor fünfzehn Jahren nur marginales Interesse gefunden, jetzt ist er allenthalben gefragt. Manche Dinge werden uns von rechts überholen, das meine ich jetzt nicht politisch, wenn wir sie links liegen lassen. Vaterland scheint uns im Moment entbehrlich, aber unter der Oberfläche kollidiert es mit dem Begriff Heimat wie Packeisschollen, und wechselweise wird eines von beiden nach oben getrieben, unter Verlust aller Manövrierfähigkeit. Darum auch habe ich das Buch geschrieben, um diese Begriffe beweglich zu halten.
Was bringt uns denn das Vaterland mehr als der Begriff Heimat?
Es sind ganz verschiedene Dinge. Sprachgeschichtlich gesehen war Vaterland, also des Vaters Acker, das kleine Geschwister der Heimat, als welche man einen ganzen Landstrich bezeichnete. Nun ist es umgekehrt, die Heimat das Nahe, das Vaterland fern. Dazwischen lag die schwere Geburt Deutschlands aus dem Geiste der napoleonischen Fremdherrschaft; wir haben uns eine Idee für den modernen Vaterlandsbegriff vom lateinischen patria geliehen.
… wie ja auch eines der Kapitel in Ihrem Gedichtband heißt.
Genau, das Kapitel, das mehrheitlich politische Gedichte, zumal zur aktuellen Lage beinhaltet. Darüber hinaus bin ich aber durch das Buch, an dem ich fünf Jahre gearbeitet habe, zu dem Schluss gekommen, Vaterland als transzendierte Heimat anzusehen. Ich meine: Heimat ist uns geschenkt, damit wir an ihr das Vermögen entwickeln können, etwas Geschichtliches und damit Formbares zu erfahren. Geschichtlich, weil wir darin leben, und formbar durch die Veränderung, die das andere und wir selbst nehmen. Formbar und deshalb zugänglich. Vaterland ist abstrakt, es hat keine Grenze, es hat keine Sprache, es lässt unser Herz nicht schneller schlagen. Aber wir können es uns zu eigen machen, so wie Heimat uns eigen ist. Vaterland ist das, wogegen wir eine Pflicht haben, Heimat, worauf wir ein Recht haben.
Das klingt in Zeiten allgemeiner Selbstbedienungsmentalität fast weltfremd oder utopisch?
Das mag sein, aber wir entkommen diesem Moment von Pflicht ja doch nie. Es ist eine Illusion, wenn wir die Beziehungen zu anderen Menschen, vor allem uns nahestehenden Menschen, und zu allen Dingen und Verhältnissen in unserem Leben nur unter dem Aspekt wahrnehmen, wie sie uns formen, was sie uns bringen. Natürlich tun sie das. Aber es gibt eben auch die andere Seite, sie nehmen uns in die Pflicht. Dieser Moment interessiert mich in „V“, es geht nicht um Identität, auch nicht um die Versuche, sie zu gewinnen – manch einer hatte überhaupt nicht die Gelegenheit, eine prägende Erfahrung mit Heimat zu machen, sondern eher mit Heimatlosigkeit. Mich interessiert, wie die Erfahrung von Heimat zugleich in die Pflicht nimmt, das Erworbene auf etwas weiter Gefasstes, Abstrakteres anzuwenden. Das leistet der Begriff Vaterland. Es geht um Identifizierung mit einer menschlichen Gemeinschaft. Vaterland ist demnach nie etwas, was ist, sondern ein Anspruch, den wir an uns tun. Es geht um Verbindlichkeit, Verlässlichkeit, Verantwortung. Und wiederum nicht für eine selbst gewählte Gemeinschaft, sondern für die, der wir durch Zufall angehören.
Hätte man den Band dann nicht auch „Vaterland“ nennen können, statt „V“?
Das wollte ich nicht, ich wollte diesem Wort keine neue Griffigkeit geben. Und sei es nur für mich selbst, die ich durch Gewöhnung ja sehr selbstverständlich mit den Titeln meiner Bücher umgehe. Der Titel ist ja quasi der Griff eines Buches, irgendwo muss man es anpacken. Der Sinn des Titels „V“ ist aber gerade, dass man immer wieder überlegen muss, wie packe ich es an. Das ist letzten Endes nichts anderes als der dichterische Umgang mit etwas, im Gegensatz etwa zum politischen. „V“ hat außerdem auch noch einen Anklang an den Brechtschen „V-Effekt“: die Illusion soll uns verwehrt bleiben.
Ich muss gestehen, dass ich an Thomas Pynchon gedacht habe, an seinen irrwitzigen „V.“- Roman, der eigentlich ein anarchischer Abgesang ans Vaterländische ist, das freilich in Amerika groteske Blüten treibt. Da gibt es ein Department of Homeland Security, das „Heimatschutz-Ministerium“, das mit totaler Überwachung einen Terror bekämpfen will, den es selber schürt.
Die Assoziation liegt wegen des Titels natürlich nahe. Tatsächlich haben die beiden Bücher nicht viel miteinander gemeinsam. Die Tendenz, festzuzurren und zu verengen, wohnt dem Begriff Vaterland inne, und wenn man so will kann man die beschriebenen Auswüchse als Aspekte dieser Tendenz sehen. Wobei das amerikanische „homeland“ und das deutsche „Vaterland“ wegen der geschichtlichen Dimension, die einem solchen Wort immer eingeschrieben ist, zwei völlig verschiedene Dinge sind.
Für Volk und Vaterland zog man hierzulande auf die Schlachtfelder.
Ja, „Vaterland“ gehört ganz sicher zu den Worten, die Klemperer vergraben und nicht wieder ausgegraben wissen wollte. Aber wie es mit vergrabenen Dingen ist, weiß jeder, der einen Hund hat: Sie tauchen manchmal ungewollt wieder auf und dann können sie geradezu zu Wiedergängern werden. Besser man schaut immer mal nach ihnen.
Was die schmissige Formel „Volk und Vaterland“ betrifft, darauf spiele ich ja mit den „Fuchs und Vaterland“-Gedichten an: Auch hier ist wieder poetischer Widerstand gefragt, und zwar der, den schon Hölderlin mit der sogenannten harten Fügung erprobt hat. Man muss die Worte neu machen. Für Wortneuschöpfungen habe ich nicht viel übrig, aber jedes einzelne Wort muss im Gedicht unbedingt neu werden, das ist die Elle, an der ich es messe.
Nun ist „V“ kein reiner Gedichtband, es sind darin Prosatexte enthalten, gar so etwas wie spieltheoretische Versuchsanordnungen. Womit haben wir es also zu tun?
In erster Linie handelt es sich um einen Konzeptband, wie es auch „Pontus“ und bereits mein erster Band „Serimunt“ waren. Mich interessiert nicht das einzelne gelungene Gedicht, es nützt mir nichts, wenn es nicht in einen reflexiven Bogen eingespannt ist, in ein Textkollektiv sozusagen, wo jeder einzelne Text das Ganze auf seine Weise befördert. Und auf seine Weise heißt eben auch, dass das zu Sagende sich seine Form suchen darf. Es geht in meinen Gedichtbänden auch um die Grenzen literarischer Formen. Die Dystopien zum Beispiel, die den Band eröffnen, sind kein Thema für ein Gedicht. Die Gesellschaft, von der darin die Rede ist, hat das Dichterische verloren, weil im Totalitarismus eben kein Platz sein darf für Dichtung. Und doch gibt es sie, auch diese Dystopien haben ihre utopischen Momente. Das ist das Thema dieser Texte: wie aus dem festen schwankender Boden und aus dem schwankenden fester Boden wird. In meinen Augen zumindest, was natürlich auch nur eine Lesart ist.
Das erklärt vielleicht auch meinen Leseeindruck: Sie heben Vergangenes und Heutiges zugleich ins poetisch Zeitlose auf und damit ins jederzeit Gegenwärtige. Vergegenwärtigen ist ja etwas anderes als Erinnern im Sinne von Zurückblicken auf etwas Vergangenes, es heißt: das Vergangene als etwas Gegenwärtiges wachzurufen, das nicht abgeschlossen ist. Wie die Beschwörungen von Schamanen. Es gibt die Distanz zwischen Einst und heute nicht mehr, auch nicht den Schnörkelrahmen des Historismus, der Guckbühne. Vielleicht ist das das „Betriebsgeheimnis“, der Prüfstein wirklicher Verdichtung: Das Naherücken durch Ausblendung der perspektivischen Distanz.
Es wäre tatsächlich schön, wenn mir das gelungen wäre. Es entspricht meinem Weltbild, Vergangenes habe ich als Kind immer in meine Gegenwart eingebaut, ich kenne noch heute dieses Gefühl, auf einem frisch gepflügten Acker zu stehen wie auf Schichten von Leben, und ich weiß noch den Moment, als ich begriff, nicht verstandesmäßig, sondern mit der Seele, wie wir wieder zu Erde werden und als solche irgendwann umgepflügt. Erinnern habe ich als Wort immer nicht verstanden, etwas in sich hineinnehmen. Mir war mehr, als ob ich selbst im Inneren bin, der kleinste Teil von etwas sehr viel Größerem. Naja, nun wird es etwas metaphysisch. Vielleicht lieber noch eine Frage?
Ja, ein paar Fragen zur Tradition habe ich noch. Wie in Serimunt und in Pontus gibt es auch in „V“ wieder ein Hölderlinzitat – ein Zeichen poetischer Verbundenheit?
Ja, das scheint ein Bund fürs Leben. Wobei Hölderlin auf den Begriff der Treue natürlich das größere Anrecht hat, weil er ihre bewahrende Notwendigkeit angesichts unserer Sehnsucht zum Ungebundenen, Chaotischen erkannt hat. Er hat vieles so klar festgehalten auf der Schwelle zwischen zwei Epochen, auf der er stand. Sein Vaterland war die Idee eines neuen Gemeinwesens von Brüderlichen, eines einigenden vaterländischen Geistes. Es kam dann anders. Und wie in „Pontus“ habe ich Fragmente zitiert, die Themen anreißen und daran scheitern, sie auszuführen. „Und niemand weiß“ war der Anfang dessen, was er über Heimat sagen wollte.
Sind Ihre Gedichte also „Vaterländische Gesänge“, die tastend nach Neuland suchen, wo es Hölder die Sprache verschlagen hat? Wo er im Hier und Heute keine Chance mehr sah für das Gemeinwesen der Brüderlichkeit?
„Vaterländische Gesänge“ können sie nimmermehr sein, aber sie suchen ein ähnliches Land. Eines, in dem sich Menschen immer wieder neu die Mühe machen, die Verhältnisse auszutarieren und auf den Prüfstein zu stellen, eines, das vor den partikularen Gewinn die Treue zum Gemeinsamen stellt. Ich bin nicht ganz hoffnungslos. Aber die Fallhöhe ist heute auch bei weitem geringer als nach der Französischen Revolution.
Nicht so offen per Zitat kenntlich, aber umso intensiver sehe ich einen anderen Autor in Ihren Band eingewoben: Kafka, dessen Texte seit hundert Jahren den Heimatlosen Asyl gewähren, denen Vaterland nichts sagt, die Pflichten und Gesetze als Verhängnisse erleben, ertragen. In den Prosatexten „Die Bienen“ und „Die Stele“ spürt man den Kafka-Gestus bis in den Tonfall hinein, ohne das unangenehme Gefühl einer Nachahmung zu haben. Im mittleren Abschnitt „limen“ sprechen Sie mit einer Dohle, die für uns im Flug schlafen soll, weil wir keine Zeit haben, weil wir „aufbrechen stündlich“. Da finden sich schrecklich-schöne Verse, wie diese: „UND WO DAS VATERLAND ANFÄNGT / ist ein dunkler Ort / wie Schnee / der die Umrisse zeigt / wie alles was aufhört“. Die Dohle aber heißt auf Tschechisch kavka.
Stimmt, ich erinnere mich. Aber meine Dohle heißt nicht Franz. Ehrlich gesagt, wo Sie schon danach fragen, heißt sie bei mir Atropos, aber das ist eine recht persönliche Vorstellung der Schicksalsgöttinnen als Rabenvögel. Doch zu Kafka: alle Dichter, die einen eigenen Ton haben, sind natürlich im kollektiven Gedächtnis und das sickert überall ins poetische Grundwasser durch. Die Prosatexte haben für mich nichts mit Kafka zu tun. Bei Kafka geht es um ein Individuum, das noch zappelt, und das bedingt den sprachlichen Charakter. Meine Texte sind Holzschnitte, Parabeln, Bühnentableaus oder Filmstills, Pathos am Rand der Komik. Aber Pathos im Wortsinn – es sieht nicht so aus, aber das sind die leidenschaftlichsten Texte in V.
Vielleicht sind Sie ihm auch darin näher, als Sie glauben. Das ist der Punkt, an dem die Leser mitreden, ihre eigenen Entdeckungen machen sollten. Ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche viele wache Leser.
Die Scheu der Stringenz
Die Scheu der Stringenz
Das Wenigste vom Text steht ja da. Und das wäre etwas zu Schönes: wenn der Text irgendwann nur noch aus einem geschriebenen Wort bestehen würde und trotzdem den Umfang beispielsweise eines Spaziergangs oder eines langen Wartens hätte. Wie aber versetzt man den auf der anderen Seite des Texts, den Leser, der man ja unter anderen Umständen auch selbst sein kann, in den Zustand, die Umgebung dieses einzigen Wortes zu lesen? – Nein, mit einem Wort gibt es keinen solchen Text, außer er stünde im Zusammenhang anderer Texte oder einem außertextlichen Zusammenhang, der Sender und Empfänger verbindet („… sie legte ihre Hand auf die meinige und sagte: ‚Klopstock!'“). Mit mehreren wenigen könnte es ihn aber geben. Die Worte konturieren das Nichtgesagte. Je schärfer die Konturen bzw. je gezielter das Nichtgesagte von Worten umstellt ist, umso deutlicher tritt es hervor. Wie nun führt der Text seinen Leser? In jedem Fall, meine ich, sollte er ihn führen, er sollte in seiner Strategie offenlegen, wie er gelesen sein will, wo es gemeinsame Wegstrecken Hand in Hand gibt und wo der Leser sich ebenso wie der Text selbst seinen Weg durchs Gelände bahnen muß. Ein Text kann eben genau diese Übergänge von der Stringenz zum Sprung vorführen, er kann seine verschiedenen Ebenen so verbinden, daß die Art der Verbindung auch auf andere Stellen des gleichen Textes übertragen werden kann, der Leser quasi in der Gangart des Textes sich in ihm fortbewegt. Woher weiß der Autor aber, wie geländesicher der Leser ist? Reise ich irgendwann allein, weil ich traumwandlerisch den Kopf unter einem Ast eingezogen habe, während der mir folgende Leser ohne eine Warnung nicht anders als dagegenlaufen konnte? Hätte ich etwas mehr sagen müssen? Konnte ich davon ausgehen, daß er weiß, das die Bäume um die Lichtung tiefer ansetzende Äste haben als im Waldinneren? Das weiß er natürlich schon, aber daß eine Lichtung kommen würde, hat er nicht sehen können, weil er immerzu nur auf meinen Rücken starren mußte, um meiner Sprunghaftigkeit überhaupt zu folgen. Und um wieviel schwieriger ist es für uns zusammenzubleiben, wenn das eigene Denken die größte Lust daran hat, die ihm als eindringlich verbunden erscheinenden Orte in kürzester Zeit im Geist zu besuchen, dieses zu jenem zu fügen, Nahes zu trennen. Übrigens ist es nicht so, daß ich hier eine Antwort auf diese Frage geben könnte.
Man könnte sich ja auch mal ein einfaches Thema nehmen, ein Gelände also, in dem die Navigation von vornherein für alle Beteiligten leichter ist. Aber man macht es dann wieder und wieder nicht, nur weil es nicht geht, etwas zu machen, bei dem man sich vor Langeweile nicht konzentrieren kann. Denn die Literatur dient mir gerade als Refugium der Komplexität. Ein Affekt (pathos) löst den Text aus. Etwas in seiner Momenthaftigkeit Unterkomplexes also, das sich jedoch bei näherer Erforschung als hochkomplex erweist, indem alles darin angelegt ist, was ich im Verlauf des Textes hervorbringen möchte, dessen Winkel und Verstecke ich zu erkunden mich aufmache, um die durch den Affekt vermutete Komplexität aufzuspüren.
Das hat verschiedene Folgen: eine davon ist die Verborgenheit der Stringenz oder besser ihre Scheu. Die schönste Stelle eines Bildes, hat ein Maler zu mir gesagt, müsse er immer übermalen, da sie sonst das ganze Bild stören würde. Aber darin, daß das Bild sie gekannt hat, ergänze ich, ist sie ja auch abwesend noch anwesend. Nämlich indem die anderen Stellen des Bildes ja in einem Bezug auf diese einmal vorhandene Stelle gestanden haben und auf sie, wie auf jede andere Stelle des Bildes, hin komponiert wurden. Wenn die eine Stelle dann auch nicht mehr da ist, so sind doch ihre Wirkungen, aus denen sich freilich nicht auf ihr Aussehen schließen lassen würde, noch im Bild. Die Scheu der Stringenz rührt also von einer Demut der Einzelheiten des Textes vor dem Ganzen her. Verschiedenes muß der Scheu der Stringenz wegen für das, was mein Text will, zurückstehen: Figuren, sie bleiben in ihrem Charakter mehr skizziert als ausgeführt, Handlung, sie würde, allzu spannend, die Aufmerksamkeit von dem, worum es geht, ablenken, Einzelheiten des Schauplatzes und der Zeit. Worum geht es: um den Moment eines aufscheinenden Dichterisch-Mythischen. Das ist, so gesagt, reichlich ungenau, angesichts der unterschiedlichen Ansätze der Mythenkonzepte. Eigentlich brauchte ich einen anderen Begriff als den des Mythischen, einen neuen, ich möchte aber auch hier lieber das nehmen, was schon da ist, als ein Neues erfinden, daß ich ebenso erst in seine Bedeutung stellen müßte wie das vorhandene. Einschränkend also: ich gebrauche den Begriff als eine Hilfskategorie.
Um nun den Kern dieses „Mythischen“ herauszuarbeiten, sehe ich zwei Möglichkeiten. Die erste ist, da es als das Dichterische nur ein „Gezeigtes Verborgenes“ sein kann, seine Aspekte zu betrachten. Die Reihenfolge dieser Aspekte, die im Text zwangsläufig eine lineare ist, bleibt dann mitunter auch eine zeitlang stringent, so daß sich ausschnittweise sogar eine Erzählung ergibt. Diese kann aber im Vollzug der Sache auch wieder verlassen werden, wenn es notwendig erscheint, einem anderen Aspekt zu folgen, der an dieser Stelle durch die veränderte Textsituation aufgerufen wird. Die Aspekte des Einen sind insofern nicht etwas Neues („wieso denn jetzt Hindukusch, eben waren wir doch noch im Museum?“) oder dichterischer Spuk, sondern im theologischen Sinn Hypostasen, die als ebenso eigenständig aufgefaßt werden müssen, wie sie an das Eine rückgebunden sind. Wie sich im Textgang um das Betrachtete die Perspektive verändert und sich neben Stadien der Zwischenperspektiven, physikalisch gesprochen: neben entropischen Zuständen, ab einer gewissen Verdichtung wieder andere Vollperspektiven bzw. Zustandsräume ergeben, so sind dabei interessant, weil einzigartig, nicht die Vollperspektiven sondern die Zwischenperspektiven, die ganz wie entropische Zustände in ihrem Vollzug irreversibel sind. Ich meine, wenn man um das Betrachtete, der Einfachheit halber nehme ich mal eine Skulptur, wieder zurückgeht, so kann man doch nicht wieder die vorhergehende Perspektive, die man an derselben Stelle in die andere Richtung sich bewegend, innehatte, einnehmen. Denn auf der dem Wahrnehmen zwangsläufigen Suche nach Kohärenz ergänzt man die unvollständige Zwischenperspektive bzw. Mischungslücke aus dem Zusammenhang des Vorherigen heraus. Die so aus der Zwischenperspektive gewonnene Ansicht des Gegenstandes ist die mir liebste, weil ich sie am wenigsten intendiert habe. Möglicherweise dienen die Vollperspektiven mir nur dazu, auf dem Weg zwischen ihnen mich der Entropie aussetzen zu können.
Eine weitere Möglichkeit, dem Mythos nachzugehen oder: nach dem Unsichtbaren zu starren, ist für mich, es in Bezug zu setzen bzw. das Sichtbare, mit ihm in Verbindung Stehende, untereinander in Bezug zu setzen und zu vergleichen. Das geht am prägnantesten, indem wesentliche Bedingungen wie Ort oder Zeit in Übereinstimmung gebracht werden (also z.B. eine Konstellation zu gleicher Zeit am anderen Ort zu denken oder zu anderer Zeit am gleichen Ort, einer der beiden Parameter muß jedenfalls gleich bleiben, da ja sonst kein Vergleich möglich ist). So ergibt sich die Möglichkeit, das Unsichtbare mit einem Sichtbaren in Deckungsgleichheit zu sehen. Was ich sagen will, ist schlicht, aber für mich immer noch eine der größten Provokationen des menschlichen Geistes (Provokation deshalb, weil es in der Möglichkeit des Geistes liegt und ihn dennoch überschreitet): die Disparität von Zeit oder Ort zusammenzuführen und die sich daraus ergebenden Verschiebungen zu betrachten. Schlicht außerdem deshalb, weil ich mir das Verfahren des Vergleichens gerne als ein geometrisches vorstelle. Die Geschlossenheit eines geometrischen oder überhaupt mathematischen Systems ist ja die reine Lust des Geistes und natürlich kann man seine Gesetze auf etwas außerhalb seines Systems liegendes wie Sprache nicht anwenden. Schlicht also, weil es schlicht nicht möglich ist. Aber gerade wegen dieser lockenden Schlichtheit und wegen ihrer Unmöglichkeit kann ich die Finger nicht davon lassen. Es ist immerhin nicht so leicht, etwas zu finden, das ein vollkommenes Instrument für die ihm zugedachten Zwecke ist (außerhalb der Mathematik kenne ich kein solches) und nur aus einer nicht in ihm liegenden Schuld nicht anwendbar ist. Die Schuld bzw. Verantwortlichkeit ist vielmehr meine, daß ich es seinen Bedingungen entreiße und in ein ihm Fremdes bringe. Und das deckt sich ziemlich mit der Schuldigkeit, die ich dem Stoff gegenüber empfinde: daß ich ein ihm vollkommen Entsprechendes, aber gänzlich Fremdes ihm zugeselle, an dem er zu einem anderen werden kann. Beide natürlich werden zu anderem. Was den weiteren Vorteil hat, daß die Mittel oder Werkzeuge nach jedem solchen Vorgang verbraucht sind und neu erfunden werden müssen und er unwiederholbar ist, weil beide Ausgangsstoffe nicht mehr vorhanden sind.
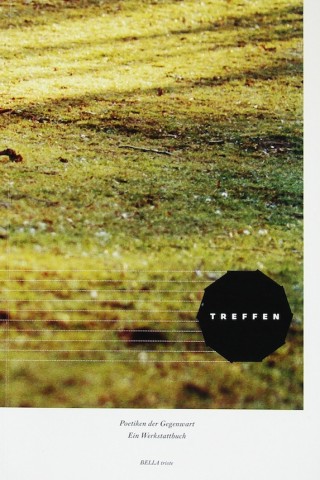
treffen – Poetiken der Gegenwart
Ein Werkstattbuch
Hildesheim, BELLA triste 2008
ISBN 978-3-9812363-0-9
