XXIII
„Anne! Kannst du mit den Jungen zur alten Klinik kommen? Ich warte dort auf dich, wir fahren ans Meer.“
Er legt auf. Es klingelt, aber er geht nicht ran. Nein, keine Nachfragen, sie soll einfach ein paar Sachen zusammenpacken. Es gibt da nichts zu fragen.
Die alte Klinik hat er gesagt, er ist sich gar nicht sicher, ob Anne die kennt, und der nächstgelegene Treffpunkt ist es auch nicht. Aber dort hat einmal sein Leben angefangen. Dort in den langen weißen Fluchten mit dem Rhythmus der Lichtstreifen, die durch die Türen fallen. Er war wieder zum Ausgang gelaufen, wo er doch hatte springen wollen. Sechzehn Jahre war das her. Eine sechzehnjährige Ruine muss man auch erst mal werden.
In einer Stunde wird er dort sein. Der Morgen ist frisch und klar, die Autobahn fast leer. Er wird nach Weißenhaus fahren mit Anne und den Jungen. Erst mal nur nach Weißenhaus, dann wird er weitersehen. Von dort sind es nur ein paar Kilometer bis zum Truppenübungsplatz. Und er wird am Meer sein, wie an den besten der Seedorfer Sonntagen.
Als er auf den Parkplatz einbiegt, sieht er schon ihr Auto.
„Das ging aber schnell“, ruft er ihr beim Aussteigen über das Autodach zu.
Sie lächelt ihn an. „Ich hatte schon gepackt, als du anriefst.“
Er fragt nicht, woher sie wusste … es war nicht wichtig, nicht nach dieser Nacht. Nur kurz streift ihn der Gedanke, welches Mysterium die Ehe ist, ein größeres als die Liebe. Anne trägt ein blaues Kleid, das er nicht kennt. Er schaut ihr zu, wie sie einen Koffer in den Kofferraum hebt, ihre Armmuskeln, ihre Wirbelsäule, die sich durch den dünnen Stoff abzeichnet. Der Große hilft. Schweigsam. Nein, leicht wird es nicht, aber er kann nicht in den Container zurück, in das provisorische Leben, das sich wie ein Gurt um ihn gezogen hat. Der Kleine strahlt und versucht, seine Aufregung zu beherrschen. Sie haben sogar an die Hängematte gedacht.
Sie fahren los. Anne verteilt Brote mit Spiegelei. Cons dreht die Musik laut, selbst der Große scheint sich innerlich lang zu machen. Cons beobachtet ihn im Rückspiegel, wie er kauend mit seiner verspiegelten Sonnenbrille aus dem Fenster schaut und wegen seiner Ohrstöpsel vermutlich gar nichts mitbekommt. Der Kleine redet und redet, aber keiner hört ihm zu und es macht ihm nichts aus. Anne holt einen Taschenspiegel raus und zieht ihre Lippen nach. Er hat sie lange nicht so gesehen. Sie legt ihre Hand auf seinen rechten Oberschenkel. Er mag das nicht, weil es ihn beim Schalten stört, aber heute ist es schön.
„Wo fahren wir eigentlich hin“, fragt Anne durch den Lärm der Musik und des Fahrtwinds. „Nach Weißenhaus“, schreit Cons zurück. „Das ist direkt am Meer, und da gibt es auch genug freie Quartiere.“
Anne ist zufrieden, und er genießt ihre stumme Anlehnung. Es ist acht Uhr dreißig, in fünf Stunden können sie in Weißenhaus sein. Mein Gott, war es vielleicht all die Jahre so leicht gewesen, dieses ganze verdrehte Leben hinter sich zu lassen? Einfach ans Meer fahren, mit der Familie ans Meer fahren, den Container hinter sich lassen. So einfach, wie nicht zu springen, wenn einer kommt und einen anschreit: Du Arsch. So einfach, wie weiterzuleben, wenn ein anderer den Kampf verloren hat und tot ist. Darum ging es doch im Soldatenspiel, für das er fast sein halbes Leben lang trainiert hatte: Wer lebt, hat gewonnen, so lange, bis er tot ist. Er drückt den Zigarettenanzünder rein und kramt im Seitenfach, doch gleich fällt es ihm ein: die Kinder. Der Kleine ist eingeschlafen. Der Große scheint mit seiner Sonnenbrille noch immer aus dem Fenster zu sehen, oder er ist auch eingeschlafen. Cons dreht die Musik leiser.
„Er wollte erst nicht mitkommen“, Anne sagt es leise mit einem Blick auf Chris, „aber ich habe ihm gesagt, dass es vielleicht der letzte Urlaub sein könnte, den wir alle zusammen machen.“ Cons nickt, obwohl er sich fragt, wie sie das meint. Wieso der letzte? Chris war zwölf. Oder dreizehn. Ganz kurz ist Cons darüber unsicher, versucht sich an den letzten Geburtstag zu erinnern, den vorletzten. Er hatte mal gegrillt für Chris und seine Freunde, aber das war schon lange her.
„Geht er denn gerade gern in die Schule?“, fragt er, um das Gespräch nicht gleich wieder verebben zu lassen. Er hat lange nicht mit Anne über die Kinder gesprochen. So wie früher, als das ihr gemeinsamer Auftrag war, wie sie manchmal gesagt hatte, um ihn wegen seines Redens von der Auftragstaktik aufzuziehen. In den ersten Jahren bei der Armee hatte er sogar überlegt, ob ihm das nicht Auftrag genug sein sollte, ob er nicht die paar Jahre noch runterreißen sollte und dann etwas Ziviles machen, Gärtner vielleicht.
„Ich weiß es nicht, ich weiß nichts mehr über ihn“, Anne nimmt ihre Hand von seinem Bein. „Ich denke manchmal, es bedrückt ihn etwas, aber kann sein, er ist in der Schule ganz anders. Ich glaube, die Jahre, in denen wir ihn gekannt haben, sind vorbei. Er lebt zwar noch bei uns, aber eigentlich ist er schon weg. So schnell ging das, und wir haben unser Leben zu viert noch gar nicht angefangen.“
„Aber er ist doch erst zwölf.“ Da Anne nicht protestiert, wird es wohl stimmen.
„Er wünscht sich ein eigenes Zimmer“, sagt sie.
„Ja, wir sollten dort wegziehen, das Haus wird nie fertig.“
Sie sieht ihn überrascht an: „Und die Schulden?“
„Es gibt keine Schulden, Anne, keine wirklichen Schulden, es ist nur Geld. Wir müssen nur aufbrechen.“
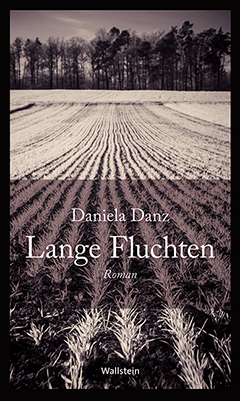
Lange Fluchten. Roman
Wallstein Verlag, Göttingen 2016
ISBN: 978-3-8353-1841-0
Preis: 18,90 Euro
